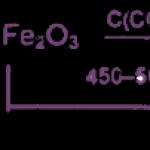Neben dem Ideal einer vollkommenen Persönlichkeit, einem nach evangelischer oder apostolischer Moral lebenden Heiligen, stellte die Feudalzeit das Ideal des „tapferen Ritters“ und dann des „Mannes von Ehre“ (honnete homme) in den Vordergrund. Dabei handelt es sich um ein individualistisches, nicht-intellektuelles, in schöne Formen gekleidetes Lebensideal mit hoher ethischer Bedeutung, das über mehrere Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben ist. I. Huizinga charakterisiert das feudal-ritterliche Ideal als „Weg der Träume“, Träume vom Glück, Ausschmückung der Wirklichkeit, ja sogar als Gesellschaftsspiel, als Bühnenmoment 1 (1 Huizinga J. Herbst des Mittelalters. Werke: In 3 Bänden M., 1995. T. 1). M. Ossovskaya glaubt, dass „... der Ritterkodex explizit im Spätmittelalter formuliert wurde, als die wachsende Bedeutung des Bürgertums das Rittertum dazu zwang, eine „defensive“ Kodifizierung seiner eigenen Normen zu entwickeln“ 2 (2 Ossovskaya M. Ritter und Bürger. Studien zur Geschichte der Moral. M., 1987. S. 103). Überforderung erklärt sich aus der Psychologie einer relativ kleinen Gruppe, in der persönliche Beziehungen Vorrang vor anonymen haben und im Namen der Selbstverteidigung dieser Gruppe vorgebracht werden. Schwierige Tugenden werden als Abwehr gegen Emporkömmlinge von unten und gegen diejenigen gepflegt, die der ritterlichen Moral ihr eigenes Wertesystem entgegenstellen. Ritterliche Tugenden sollen die Distanz zwischen Trägern adeliger Eigenschaften und Menschen anderer Staaten und Stände verdeutlichen. Die Ritterlichkeit greift auf christliche Symbolik zurück. Die militante Aristokratie begründet ihr Recht auf Krieg allein mit christlichen Prinzipien (der Symbolik des Schwertes) und greift, um ihren Charakter zu mildern, auf die Ideen christlicher Demut und Barmherzigkeit zurück. Generell verbleibt das Privileg des Moralisierens bei der Kirche. Christliches Moralisieren, das weltlichen Herrschern in den Mund gelegt wird, gilt als Heuchelei. Der „Ehrenmann“ (XV.-XVII. Jahrhundert) ist völlig frei von Religiosität und steht religiösen Predigten gleichgültig gegenüber.
Ritterliche Partnerschaften, gebunden durch Gelübde, gemeinsame Führung, gegenseitige Verpflichtungen und Aufgaben, mit eigenen Normen und Vorstellungen von Ehre und Gerechtigkeit, sind als militärisches Bündnis eine politische Organisationsform der höchsten gesellschaftlichen Schicht im Mittelalter, stärker vereint als ein verwandter Clan. Diese Beziehungen werden als neue Realität durch Partikulargesetze festgelegt, die sich im 5.-8. Jahrhundert verbreiteten. Dies sind verschiedene „Wahrheiten“ (alamanische Wahrheit, bayerische Wahrheit), die Gesetze von Gundobar, der Leovigild-Kodex usw.
Der Prototyp eines Ritters ist ein Reiter, der professionell Waffen führt, gesund, ausgebildet, ausgerüstet, frei ist und daher die Macht über Leben und Tod der Unbewaffneten, Schwachen, Abhängigen, Feigen hat: „In den Köpfen der fränkischen Aristokratie ein abhängiger Staat wurde mit Feigheit und Gemeinheit gleichgesetzt. Wer unbewaffnet war, galt als Feigling. Es spielt keine Rolle, dass der Waffenmangel dieser oder jener Person auf sozioökonomische Gründe zurückzuführen ist und nicht auf seine moralischen oder körperlichen Qualitäten. Ein Mann ohne Waffe ist ein abhängiger Sklave“ 1 (1 CardiniF. Die Ursprünge des mittelalterlichen Rittertums. M., 1987. S. 305). Vom Anfang des 9. Jahrhunderts. Der Gegensatz „Reiter – Lakai“, „bewaffnet – unbewaffnet“, „frei – abhängiger Sklave“ entwickelt sich zu einem ethischen Kontrast zwischen einem tapferen, edlen Ritter und einem unterwürfigen, feigen, selbstwertlosen, niederträchtigen und machtlosen Bürger.
Ritterlichkeit (vom deutschen Ritter – Reiter, Ritter, lat. Miles, fr. Chevalier) – eine soziale Gruppe mit Sonderstatus, mit eigenem Wertesystem und Verhaltensnormen, die in der Spätphase der feudalen Gesellschaft in den Ländern entstand West- und Mitteleuropa im 11.–12. Jahrhundert. und deckt alle weltlichen Feudalherren oder Teile davon ab. Der Rittertitel ist ein Personentitel. Ritter unterscheiden sich von der feudalen Aristokratie, dem Adel, der seiner Herkunft nach edel ist (französischer Gentil und deutscher Herr – bzw. edler Aristokrat und Herr, Meister). Zunächst wurden Ritter von Nobilis unterschieden, d. h. Landmagnaten, die Familienbesitz und erbliche Titel besaßen und stolz auf ihre hohe Herkunft waren. Als Ritterschaft bezeichnet man die kleinen weltlichen Feudalherren, auch abgegrenzt vom Klerus, eine Berufsgruppe bestehend aus sozial und wirtschaftlich abhängigen Soldaten (milites) und dem Verwaltungsapparat (ministeriales), dem Gefolge eines großen Feudalherren, der auf seinen Ländereien oder in der Umgebung lebt Schloss selbst. Der Ritter konnte seinen Dienst nicht verlassen. Die Ritter standen in Vasallenabhängigkeit von ihrem Oberherrn und erhielten Einkünfte aus ihnen gewährten Ländereien (Lehen, Lehen) als Bezahlung für Dienst, Loyalität und Unterstützung bei Militärexpeditionen und Schutz vor dem Feind. Bei Verletzung übernommener Verpflichtungen, Unehrlichkeit oder Verrat eines Ritters konnte der Feudalherr das Lehen wegnehmen. Zum ritterlichen Verhaltenskodex gehören Loyalität, Missachtung von Gefahren und Mut, die Bereitschaft, die christliche Kirche und ihre Geistlichen zu verteidigen und verarmten und schwachen Mitgliedern ritterlicher Familien Hilfe zu leisten. Die Ritterlichkeit konzentriert sich auf die Werte der höchsten Klasse, Großzügigkeit, Extravaganz, Brillanz und Prunk, Unterhaltung, für die Ritter bereit sind, große Ausgaben zu tätigen. Diese Ausgaben übersteigen ihre Einnahmen und sind nicht tragbar. Die Nachahmung des Adels ruiniert den Ritter als Grundbesitzer und macht ihn noch abhängiger von Zuwendungen, die zunehmend in Geld statt in Immobilien erfolgen. Nach dem Vorbild adliger und erblicher Feudalherren betrachteten die Ritter Handel und Handarbeit, insbesondere Bauernarbeit, als unwürdig und niedrig. Um den Status eines Ritters zu erlangen, war es notwendig, sich einem Ritterritual zu unterziehen, das symbolisch die gegenseitigen Verpflichtungen von Oberherr und Vasall sicherte (bei diesem Ritual legt der kniende Vasall seine Hände in die Hände des Oberherrn, d. h. er vertraut sich an). ihm gehorcht und hat gleichzeitig das Recht, von diesen Händen Belohnungen zu erwarten). Das Ritterritual verbreitete sich zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Rittertum bedeutet eine magische Beförderung, Auswahl, Eintritt in eine privilegierte Klasse und gleichzeitig die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, das Bewusstsein für die eigene ethische Mission, Gott und dem König zu dienen, einen aristokratischen Nachnamen, die Schirmherrschaft über die Schwachen (obligare – vom Wort her). „binden“, „binden“, in diesem Fall buchstäblich die Hände des Vasallen und Oberherrn mit einem Schal binden). Im 11. Jahrhundert Ritter-Dichter und der Kult der schönen Dame erscheinen, die der höchsten Aristokratie angehörte und daher unzugänglich war, als Gegenstand der Verehrung von Bedeutung. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erlebten die höfische Lyrik und Romantik ihre Blütezeit. Ritterliche Sentimentalität ist vor allem ein ästhetisches Phänomen und eine säkulare Norm, die die grobe Realität verschönert, aber auch ein Ausdruck von Schmeichelei und Distanz ist, etwas, das dem religiösen Gottesdienst und der Anbetung entgegengesetzt ist und gleichzeitig mit religiösen Gefühlen und Haltungen verwandt ist.
Die Zahl der Ritter nahm in absoluten Zahlen und im Verhältnis zum Adel deutlich zu. Mit der Zeit wird der Rittertitel zu einem erblichen Titel, der unter bestimmten Voraussetzungen vom Vater auf den Sohn übergeht. Ritter gelten heute als Adlige und Adel und Rittertum sind zu einer einzigen Klasse verschmolzen. Insbesondere in Frankreich wurde der Rittertitel erst durch die Große Französische Revolution abgeschafft. Während der Herrschaft Ludwigs Der Adelsbegriff entstand als Folge der Religionskriege des 16.-17. Jahrhunderts, in der Zeit des Absolutismus und der Krise der Vasallenverhältnisse. Die Bürger waren den ritterlichen Idealen sehr verbunden, als sie für die Unabhängigkeit der städtischen Gemeinschaft von feudalen Institutionen kämpften, identifizierten sich mit einem tapferen Ritter, einem Verfechter der Gerechtigkeit, einem freien und entschlossenen Menschen, einem idealen Helden.
Das Bündnis von Rittertum und Klerus zerfiel nach der Zeit der Kreuzzüge. Säkulare Feudalherren neigten nie besonders zur Religion; sie konnten je nach politischem Gewinn sowohl die katholische Kirche als auch Häresien unterstützen und zeigten Abkühlung und Skepsis gegenüber dem Glauben, obwohl sie religiöse Erziehung und Bildung erhielten. Der Mentor der Ritter im Krieg war ein Priester, ein Kaplan. Das Rittertum war sozusagen ein „Staat im Staat“ und betonte in jeder Hinsicht seinen Unterschied zu Bürgern und Bürgern. Diese Klasse hatte ebenso wie der Klerus Bewegungsfreiheit und fühlte sich in einem Raum von Spanien über Deutschland bis Palästina oft kosmopolitisch.
Das Rittertum schuf das heroische Ideal eines christianisierten, tapferen Ritters und das weltliche Ideal der Höflichkeit, in dem sowohl militärische als auch höfische Tugenden vereint sind – sowohl Mut als auch Höflichkeit, aber nicht heroische höfische Tugenden werden zu den wichtigsten.
Das heroische Ritterideal offenbart sich in epischen Werken wie „Das Lied von Roland“, „Das Lied von Sid“ und „Das Lied der Nibelungen“. Diese stammen aus dem 12. Jahrhundert. Die Gedichte stellen die ritterlichen Sitten einer früheren Zeit dar. Die Geschichte vom Märtyrertum und heldenhaften Tod Rolands in der Schlacht der Franken mit den Mauren bei Roncesvalles (778) erzählt von Mut, Ehre, Loyalität, Freundschaft, Verrat, Rücksichtslosigkeit, Grausamkeit sowie der Liebe zum „lieben Frankreich“. Das Handeln von Rittern wird durch religiöse Pflichten und Vasallenpflichten bestimmt. Militärische Heldentaten sind für sie Selbstzweck. Im Bereich des abenteuerlichen Heldentums werden ihr persönlicher Mut, ihre Energie, ihr Charakter und ihr sozialer Status offenbart und überprüft. Über Roland und Olivier kann man mit den Worten des griechischen Epitaphs sagen: „Sie waren sowohl im Krieg als auch in der Freundschaft treu.“ Priester Turpen, ein Teilnehmer der Schlacht, der viele bereits tödlich verwundete Feinde persönlich getötet hat, kriecht von einem sterbenden Ritter zum anderen, um das Abschiedsgebet zu lesen und seine pastorale Pflicht zu erfüllen.
„Das Nibelungenlied“ (13. Jahrhundert) ist eine Erinnerung an das Massaker an den Burgundern, das die Hunnen während der Völkerwanderungszeit, genauer gesagt im 5. Jahrhundert, verübten. Das Gedicht repräsentiert das altgermanische Heldenepos, die Erzählungen barbarischer Völker und ist zugleich von der Atmosphäre höfischer Kultur durchdrungen. Dies ist eine Geschichte von Täuschung, Klassenstolz und persönlicher Rache.
Der Imperativ des Verhaltens der Charaktere ist die Vasallenpflicht, die in dem Ausdruck „wie Ehre und Pflicht es vorschreiben“ enthalten ist. Dies ist eine Klassennorm, die die Beziehungen der Ritter durchdringt, über Verwandtschaftsbeziehungen steht und lebenslang gültig ist. Zugleich handelt es sich hierbei auch um eine feudale Form des Zwanges, die dem Vasallen seine Unabhängigkeit nimmt. Er ist verpflichtet, jedes Schicksal des Oberherrn zu teilen und gegebenenfalls auf moralische Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen zu verzichten, nicht auf den gesunden Menschenverstand zu hören und seine eigenen Eigensinne nicht zu berücksichtigen. Aus Vasallenpflicht müssen Ritter diejenigen töten, die ihnen lieb und teuer sind und die ihnen Gutes getan haben. Im „Lied der Nibelungen“ wird dieser Zusammenstoß in den Vordergrund gerückt. Die Vasallenpflicht wird durch den Eid des Ritters und die großzügigen Gaben des Herrn gesichert.
Auch die poetische Erzählung, wie Kriemhild sich für den abscheulichen Mord an Siegfried brutal rächt, spricht von den Qualitäten des Ritters. Darunter sind Großzügigkeit, Mut, Großzügigkeit, Loyalität, Furchtlosigkeit, Höflichkeit, Gastfreundschaft, Freundschaft, Adel, Freundlichkeit. Ritterlicher Stolz, Hochmut, Prahlerei, Hochmut, Hochmut und Verrat sind verwerflich. Kampfqualitäten werden immer hoch bewertet, unabhängig davon, ob der Kämpfer Recht oder Unrecht, edel oder niederträchtig ist.
Ritter sind mit Fehden, Festen, Spaß und Jagd beschäftigt. Mit Interesse und großem Gefühl wird die Vorbereitung zeremonieller Gewänder, luxuriös gekleideter Damen und Ritter, der Reichtum der Kleidung und der militärischen Gewänder 1 (1. Nibelungenlied. M., 1972. S. 112-113) sowie das Fest gefeiert Utensilien und Lebensmittel werden beschrieben. Einen wichtigen Stellenwert nehmen Zeremonien, Konzile der Könige mit Vasallen, Ritterschläge, Beerdigungen, Hochzeiten und Kirchenbesuche ein. Der Text enthält kein religiöses Thema, obwohl Kriemhild eine zweite Ehe mit dem Hunnen, dem Heiden Etzel (Attila), hat, da er ein Christ ist. Es gibt eine christliche Kirche, Mönche und Geistliche. Religiosität ist jedoch kein charakteristisches Merkmal von Rittern. Sie denken nicht wie Gläubige, berufen sich nicht auf christliche Gebote und neigen nicht zum Beten. In einem verschlossenen, brennenden Raum, in Dämpfen und Hitze, ohne Wasser, in Kampfkleidung stillen die Ritter ihren Durst mit Blut, das aus den frischen Leichen der besiegten Feinde fließt, und sagen, dass es besser schmeckt als Wein.
Das Gedicht handelt von einem unzähligen Schatz, dem im Rhein versenkten Gold der Nibelungen, dem Eigentum von Kriemhild und Siegfried. Wo von Status die Rede ist, ist auch von Eigentum die Rede. Der Oberherr bindet seine Vasallen durch großzügige Geschenke, Geld und Grundstücke an sich. Reichtum schafft Diener und Unterstützer für ihn. Das Motiv der Bereicherung wird nicht als Korruption, Gier oder Gemeinheit der Natur interpretiert. Reichtum wird als Honorar, Ehre, Respekt vor Tapferkeit und Herkunft, vor persönlichen Verdiensten wahrgenommen. Verhaltensmotive wie Eifersucht, Neid und Gier bleiben scheinbar unbemerkt. Sie werden von Affekten wie Stolz, Scham, Wut und Rachsucht überschattet. Kollektive Gefühle und die Bereitschaft zur Empathie sind spürbar, zum Beispiel erleben alle Ritter Wut und Trauer, die ganze Stadt weint oder jubelt, die Fürsorge und Trauer eines Adligen spiegelt sich in der Stimmung der Höflinge wider. Wenn es eine Sondermeinung gibt, dann ist sie entweder zu naiv wohlwollend oder böswillig, heimtückisch. Nur wenige zweifeln, schämen sich und werden von der ihnen zugewiesenen Rolle abgelenkt.
Das alte spanische Epos „Lied von Sid“ (Mitte des 12. Jahrhunderts) erzählt die Geschichte der Vertreibung des in Ungnade gefallenen und kriegerischen Sid, der durch Banditenangriffe gezwungen wurde, nachdem er seinen eigenen Besitz verloren hatte, die um ihn versammelten Krieger zu unterstützen. Jubelnde Gier brennt in diesem Werk: „Nimm deinen Lebensunterhalt ohne Angst“, „raube die Mauren ohne Gnade aus.“ Gewinn, Reichtum bedeutet Spaß, Freude, Freude. „Oh Gott, wie hat er alle seine Gläubigen bezahlt, alle seine Vasallen, sowohl zu Pferd als auch zu Fuß!“ 1 (1 Lied von Sid. Altes spanisches Heldenepos. M.; L.; 1959. S. 37, 39): „Man kann keinen armen Mann in seiner ganzen Truppe finden. Bei dem guten Herrn lebt jeder im Überfluss“ 2 (2 Auerbach E. Mimesis. Bild der Realität in der westeuropäischen Literatur M., 1976. S. 148). Hand in Hand mit Sid beraubte der tapfere Priester Don Jerome. Der im Exil lebende Sid ist kein Träger höfischer Moral. Er ist ein launischer und souveräner, glücklicher und großzügiger Heerführer, der fair zu seinen Kameraden ist und Gewalt zu seinem Vorteil einsetzt.
Die Christianisierung des europäischen Ritterideals, die Entwicklung ethischer Prinzipien ritterlichen Verhaltens, gefüllt mit religiös erhabenen Inhalten und Vorstellungen von Vasallenpflichten, wurde im 11.-12. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen. Die prinzipienlose Militärmacht ist nun der Kirche und der autoritären religiösen Moral untergeordnet. Die gesamte Existenz des Ritters, alle seine Gedanken drehen sich um den Krieg als Handwerk und Privileg. Das Rittertum schafft seine eigene besondere Welt, behauptet sich in besonderer Weise als Klasse: „Die Welt der ritterlichen Selbstbehauptung ist eine Welt des Abenteuers; es enthält nicht nur eine fast ununterbrochene Reihe von „Abenteuern“, sondern vor allem nichts, was nicht mit dem „Abenteuer“ in Zusammenhang steht, nichts, was nicht der Schauplatz des Abenteuers oder die Vorarbeit dazu ist; Dies ist eine Welt, die speziell für die Selbstbestätigung eines Ritters geschaffen und angepasst wurde.“ Die Aktivitäten der Ritter, nämlich Krieg, Jagd, Turniere, Feste, sind ihr ausschließliches Recht. Anderen ist die Teilnahme an diesen Aktivitäten nicht gestattet. Alle Probleme werden als religiöse, Status-, Klassenprobleme, als Eingriff und Beleidigung der Ehre und des Heiligen betrachtet. Das komplizierte System von Abhängigkeiten und Patronage führt zwangsläufig zu weit verbreiteten Pflichtverletzungen und Verrat im Falle eines Konflikts zwischen verschiedenen Verantwortlichkeiten. Kollisionen und Zusammenstöße werden entweder gewaltsam oder symbolisch gelöst. Die rechtliche Methode zur Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten erlangte erst im 12. Jahrhundert eine gewisse Bedeutung. im Zusammenhang mit der Rückkehr des römischen Rechts zur Praxis, insbesondere der Gesetze Justinians. Die Ritterschaft verfolgte keine Sozialpolitik und beteiligte sich nicht am Wirtschaftsleben. Sie teilte die religiöse Verachtung der Akkumulation, sofern diese nicht mit der Vorbereitung einer militärischen Intervention, „Kreuzzügen“ oder saisonalen Kriegen verbunden war. Die Ritter stellten keine großen Ansprüche an Hygiene und Komfort. Das wertvollste Eigentum passte auf mehrere Karren und bildete einen leicht transportierbaren Konvoi. Den höchsten symbolischen und materiellen Wert hatten Waffen, Militärkleidung und Standesattribute. Der wichtigste hedonische Wert war Essen. Die Qualität der Nahrung und das Sättigungsgefühl zeichnen das Leben der Oberschicht aus, obwohl der mittelalterliche Westen, um es mit den Worten von J. Le Goff zu sagen, „ein Universum des Hungers“ war. Ritterfeste bedeuten nicht nur Entspannung nach dem Kampf, nicht nur eine Form der politischen Versammlung, sondern nicht zuletzt eine Gelegenheit, nach Herzenslust zu essen, jenseits der körperlichen Leistungsfähigkeit, und eine Art Gier (Hunger, Besitzgier, Aneignung, Zerstörung) zu demonstrieren. . Der destruktiven Aneignung wird eine positive Bedeutung beigemessen, während konstruktive Aneignung (Gewinn, Gewinn, Eigennutz, Lucrum) negativ gedacht wird. Das Gargantua-Syndrom wird durch das tiefe Selbstbewusstsein der Klasse bestimmt. Bis zum 15. Jahrhundert Die militärisch-technischen Fähigkeiten des Rittertums verloren mit der Erfindung des Schießpulvers im 16. Jahrhundert ihre Bedeutung. Schlagen Sie die heroischen Rittermythen. In dieser Zeit endet die Ritterlichkeit als Lebensform. Das heroische Ritterideal war kein intellektuelles.
Im Rahmen des christianisierten Ritterideals werden ritterliche Loyalität und Ehre, abgeleitet aus Vasallentum und Standesbindung, bekräftigt. Verrat an der Klassenehre ist eine Todsünde. Die Aufrechterhaltung der Klassenordnung und Gerechtigkeit obliegt den Schultern des Rittertums. Der Ritter unterliegt keiner körperlichen Bestrafung, erscheint nur vor dem Ehrengericht und trägt hauptsächlich moralische Verantwortung. Ritterliche Wappen, die nach bestimmten Regeln errichtet wurden, dokumentieren sowohl ritterliche Taten als auch Schuld. Das Konzept des Dienstes und der Hingabe bis hin zur Selbstaufopferung (Vasallenpflicht) wird mit dem Konzept der Souveränität des Feudalherrn in seinem Herrschaftsbereich kombiniert, in dem er für sein Handeln niemandem Rechenschaft schuldig ist und sich von persönlichen Vorstellungen über Recht und Gesetz leiten lässt Gerechtigkeit. Souveränität und Vasallenpflichten bilden einen Widerspruch, der in den Lastern des Rittertums zum Ausdruck kommt, nämlich Verrat, Lüge, Verrat, Feigheit, Geiz, Neid, Arroganz, Stolz.
Das ritterliche Bewusstsein ist egoistisch und betrachtet Privilegien als die Norm. Trauer berührte die Herzen der Adligen bestenfalls nur dann, wenn Menschen wie sie, die ihnen ebenbürtig waren, litten. Und selbst dann bewahrten ihre Herzen nicht lange Spuren der Trauer. Der Egoismus der Adligen war ihr von außen deutlich sichtbares Unterscheidungsmerkmal. Das Leid anderer bedeutete viel weniger als der eigene Ruf, ein guter Name, den man um jeden Preis verteidigte. Das Rittertum hielt sich nie für schuldig, Leid zu verursachen, und nutzte spezielle Techniken, um das Gefühl moralischen Grauens und der Reue zu unterdrücken. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. „Aristokrat“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch zum Synonym für das Wort „Egoist“, d. h. ein solcher Mensch, der aufgrund seines Reichtums und seiner gesellschaftlichen Stellung nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse anderer zu verstehen.
Im XI-XIII Jahrhundert. Es entsteht ein neues aristokratisches Verhaltensmodell, ein weltlicher Kodex guter Manieren und idealer Normen oder höfisch 1 (1 Höfisch – vom Wort „Hof“ (Hof – bischöflich, königlich); bezeichnet im weitesten Sinne den Lebensstil von ein Stadtbewohner im Gegensatz zum Lebensstil auf dem Land („Hinterwäldler“)): „Er ist bestrebt, einem Menschen vier Prinzipien irdischen Verhaltens zu vermitteln: Höflichkeit (statt Unhöflichkeit und Gewalt), Mut, Liebe und Großzügigkeit, Großzügigkeit.“ Dieser Kodex sollte einen zivilisierten Krieger formulieren und ihn in den Rahmen eines harmonischen Ganzen einpassen, das auf zwei Hauptgegensätzen basiert: Kultur – Natur und Mann – Frau“ 2 (2 Jacques Le Goff. MIT Vom Himmel zur Erde (Veränderungen im System der Wertorientierungen im christlichen Abendland des 12.-13. Jahrhunderts). Odysseus. M., 1991. S. 40). Im 13. Jahrhundert. Eine anspruchsvollere Höflichkeit geht mit dem Ideal der Makellosigkeit einher. Eine höfische Persönlichkeit und ein „Ehrenmann“ ist Träger einer säkularen Hofkultur, unterhaltungsorientiert, entmilitarisiert und dem Gedanken der persönlichen Selbstverwirklichung fremd. Die höfische Kultur schützt das Prinzip der Ehre: „Das formelle Ehrgefühl ist so stark, dass ein Verstoß gegen die Etikette ... wie eine tödliche Beleidigung schmerzt, weil es die schöne Illusion des eigenen erhabenen und unbefleckten Lebens zerstört, eine Illusion, die sich zurückzieht.“ vor jeder unverhüllten Realität“ 3 (3 Huizinga J. Dekret op. S. 56).
Das säkulare (höfische) moralische Ideal und die Verhaltensnorm ist Höflichkeit. Ansonsten nennt man es auch Großzügigkeit, Höflichkeit, Vornehmheit und Vornehmheit. Großzügigkeit scheint die besten ritterlichen Eigenschaften (Macht, Mut, Ehre, Großzügigkeit) sowie Aufklärung zu implizieren, ganz zu schweigen von Eigentum und sozialem Status. Bis ins 18. Jahrhundert Kultur ist mit Kultiviertheit verbunden, die das Konzept des Bürgerlichen erbt, d.h. fähig, sich gut zu benehmen, sich sanft und höflich zu verhalten, ein Gespräch zu führen, höflich, einen äußeren Glanz habend, fügsam und tolerant 1 (1 Lucien Feb. Kämpfe für die Geschichte. Zivilisation: die Entwicklung des Wortes. M., 1991). Die Renaissance-Begriffe „Virtuose“ und „Virtu“ bedeuteten Tugenden und Tapferkeit, humanistische Bildung und die Superlative des menschlichen Geistes. Nichts hinderte damals daran, die verdorbensten und unehrlichsten Menschen (zum Beispiel Alexander Borgia) „Virtuosen“ zu nennen.
Höflichkeit steht im Gegensatz zu Unhöflichkeit, Gier, Geiz, Hass, Rache und Verrat. So stellt der französische Schriftsteller Chretien de Troyes (12. Jahrhundert) Großzügigkeit der Umständlichkeit und Kleinlichkeit gegenüber und verurteilt den ritterlichen Brauch des Prahlens, Streitens, Eids und Versprechens. Er kritisiert die sarkastische Gesinnung, die den Stolz anderer verletzt, die charakteristisch für einen konfrontativen Ritter ist, der gegen jeden Einspruch erhebt und die Anwesenden dreist und arrogant erniedrigt. Stattdessen wird eine nüchternere und zurückhaltendere Kommunikation gefördert, vermittelt durch Etikette, die darauf abzielt, Arroganz, Grausamkeit, Rachsucht, Rivalität und Neid zu verbergen. Zuneigung, hypertrophierte Schmeichelei, Aufmerksamkeit und der Wunsch, dem Egozentrismus und der Eitelkeit anderer zu gefallen, entstehen. Höflichkeit maskiert die Psychologie der Macht, romantisiert und problematisiert den Alltag und schützt das Selbstbewusstsein der Klasse.
Höflichkeit drückt sich in romantischer Liebe und höfischer Freundschaft aus (Institution Günstling 2 (2 Schergen, Günstling (Freundin, Vertrauter, Freund, Vertrauter, Liebhaber, Favorit), offener Hausbesuch, besondere Gunst genießen, Konkubinat – die Institution einer zweiten Familie und nichtverschwörungsfreies Zusammenleben außerhalb der Ehe )), die nichts mit der Psychologie der Ehe zu tun haben. Die Familie lebt mit legalisierter Untreue und Polygamie zusammen. Es setzt Treue gegenüber dem Geliebten voraus, ist aber selbst legalisierte Untreue. Eifersucht wird lächerlich gemacht und es kommt häufig zu Veränderungen am Liebesobjekt. Das ist nicht das Entscheidende. Liebe dieser Art erfordert die Idealisierung des Objekts der Anbetung, des Respekts und der Angst. Es ist bemerkenswert, dass die Geliebte bei ihrem Ritterverehrer Angst hervorrufen sollte. Mit allen möglichen Gefahren vertraut, wird er vor ihr taub, wird plötzlich blass, verliert die Selbstbeherrschung, sieht seltsam und krank aus, kann bewusstlos werden, gehorcht nur ihrem Wort, ihrem Blick, ihrem Wunsch. Die Dame befiehlt und erlaubt gnädig, ihn vollständig zu entsorgen. Der Liebhaber muss seine Liebe verbergen und die Dame aus der Ferne anbeten, aus Angst, sich ihm zu nähern und sich zu öffnen, aber dann wird seine Krankheit offensichtlich und jeder erfährt von seinen Liebesqualen. Und nur in dieser Eigenschaft einer „schönen Dame“ löst eine Frau Angst und Respekt aus. Das Herren-Vasallen-Verhältnis bezieht sich auf die Beziehung zwischen Liebenden.
Mittelalterliches Wertebewusstsein und Erotik grenzen aneinander. Ein mehrdeutiges Spiel mit Begriffen, die sich sowohl auf den religiösen als auch auf den moralischen und sexuellen Bereich beziehen, ist erlaubt. Ihr Übergang ineinander kann komisch und blasphemisch ekelhaft sein, sie können Seite an Seite sein. Soweit Moral gezeigt werden kann, ist sie erotisch. Aus diesem Grund billigten die geistlichen Autoritäten ein gewisses Maß an religiösem und frommem Eifer nicht, da sie sich in solchen Fällen mit erotischen Fantasien und Übertreibungen auseinandersetzen mussten. Der frivole Moralismus der Renaissance spiegelt diesen Punkt wider.
Mittelalterliche moralische Vorstellungen und Werte werden in Bestiarien – Abhandlungen über Tiere und ihre symbolische Bedeutung – interpretiert. In ihnen werden Tiere mit den Konzepten von Religion und Moral verglichen. Bestiarien, die für die westeuropäische mittelalterliche Kultur des 12.-13. Jahrhunderts charakteristisch sind, stellen eine sinnliche Realität dar, die von religiöser und moralischer Symbolik durchdrungen ist: Beispielsweise diente ein Löwe, der Christus verkörperte, ein halb Mensch, halb Esel als Bild eines Sünders. ein Ketzer, ein Heuchler, ein Fuchs ist ein Symbol für List und Verrat, ein Einhorn – ein phallisches Symbol oder Christus im Schoß der Mutter Gottes, ein Biber ist ein gerechter Mann, der die Sünde von sich selbst abschneidet, ein Krokodil ist der Tod und die Hölle, ein Affe und ein Drache sind das Bild des Teufels. Sie dienten dem christlichen Bewusstsein als Enzyklopädie der Tierwelt, als Sammlung moralischer Lehren, als Katalog symbolischen Wissens und als Lobpreisung des Schöpfers.
Die Hofmoral des „edlen Kavaliers“ (Herren) und des „Ehrenmanns“ ist ein mittelalterliches weltliches Ethos und eine mittelalterliche Art von Kalokagathia. Es besteht aus christlichen und Cicero-stoischen Tugenden. Seine Aufgabe besteht darin, eine charismatische und charmante Persönlichkeit zu kultivieren, „elegante Moral“ im Gegensatz zum früheren militaristischen Heldenideal des geradlinigen, naiv loyalen, ungestümen, mutigen, instinktiven Ritters, der nicht über die Konsequenzen seines Verhaltens nachdenkt. Das Ideal eines gebildeten Höflings impliziert Alphabetisierung, Beredsamkeit, äußere Attraktivität und Schönheit, Gelehrsamkeit, Harmonie des „inneren Menschen“ und des Aussehens, Mäßigung und Toleranz, Einsicht und Bescheidenheit, eine Vorliebe für Intrigen und Zurückhaltung. Ein Höfling ist kein Kenner und Experte in Fragen der Theologie, mittelalterlichen theoretischen Wissens, kein tapferer Ritter, der mit Waffen in der Hand die materielle Gerechtigkeit verteidigt, sondern ein weltlicher Führer, ein Redner, der das Wort, alle Wortschattierungen und ihre Poesie meisterhaft beherrscht. subjektive Bedeutungen, ein Berufsangestellter, ein zur Ausübung weltlicher Pflichten ausgebildeter Mensch.
Das höfische Ethos lässt die alte Idee der Kalokagathia wieder aufleben. Moral und Manieren verbinden sich mit Ästhetik, einer verfeinerten Form des äußeren Verhaltens. Der Einfluss von Platonismus, Aristotelismus und Ciceronismus zeigt sich in der Konvergenz von Ethik und Rhetorik, Moral und Bildung, dem Tugendhaften und dem Schönen, dem Wunsch nach einer harmonischen Kombination von „Disziplin“ und „Dekor“ und in der Betonung der ästhetischen Aspekte der Tugend. Der höfische Moralismus und die höfische Philosophie scheinen zu beweisen, dass ein gebildeter Höfling, der Besitzer einer von außen sichtbaren „schönen Seele“, politische, repräsentative und diplomatische Rollen spielen kann. Dies ist ein Anspruch auf eine politische Funktion, ein Anspruch der herrschenden Klasse und ihrer Elite. Das ist einerseits eine Maske, hinter der sich keine Idee von Humanismus, sondern List und Pragmatismus verbirgt. B. Gracian (17. Jahrhundert) kann in seinem Werk „Das Taschenorakel oder die Wissenschaft der Klugheit“ über diese Seite der Höflichkeit berichten. Andererseits stellt die höfische Moral ein Beispiel für den mittelalterlichen Personenkult dar und dient als Prolog zu den Werten der ohnehin nichtfeudalen herrschenden Klasse, die sich durch das Konzept des aktiven Lebens und dann durch das Konzept durchsetzte der individuellen Freiheit, Werte, die die Wurzeln der europäischen Renaissance nähren. Orthodoxe, asketische, rigoristische Klosterkreise setzten das höfische Rittertum mit Lastern (Stolz, Ehrgeiz, vorgetäuschte Demut) gleich, beschuldigten es der Kalkulation und Intrige, des Bestrebens, es allen recht zu machen, und verdächtigten es auch zu Recht einer starken politischen Motivation. Es hinderte die katholische Kirche daran, Könige frei zu unterrichten.
Im frühen Mittelalter etablierte sich der Ritter als unabhängiger, tapferer Reiterkrieger. In dieser Eigenschaft war es schwierig, ihn von einem Banditen und Eindringling zu unterscheiden. Er wurde von anarchischen, destruktiven und sogar kriminellen Neigungen dominiert. Anschließend werden im Porträt des idealen Ritters Barmherzigkeit und christliche Fürsorge für die Schwachen und Beleidigten zu den Hauptmerkmalen. Es entsteht ein ethischer Mythos über den Ritter-Verteidiger, der sowohl weltliche als auch moralisch-religiöse Funktionen ausübt. Die nächste Stufe in der Entwicklung des ritterlichen Ideals ist der Kodex edler Manieren und die Ideologie der Liebe, die den Ritter nicht für militärische Siege und Heldentum, sondern für seine inneren Tugenden, seine „schöne Seele“ und seinen Verhaltensstil verherrlicht. Die Wörter „würdig“ und „Würde“ ersetzen nach und nach die Wörter „Held“ und „heldenhaft“. Außer in Fragen der persönlichen Ehre ist der Hofritter nicht bestrebt, Prinzipien aufrechtzuerhalten.
Von Anfang an war das Rittertum ein landloser Adelsstand, der im Dienste und Unterhalt des Herrschers stand. Daher sind ritterliche Ideologie und Selbstdarstellung widersprüchlicher Natur. Der Ritter ist stolz auf seine hohe Stellung und verbindet seine Verehrung und seine gesetzlichen Rechte mit herausragenden persönlichen Qualitäten, doch gleichzeitig kommt er nicht umhin zu erkennen, dass die Quelle all seiner Vorteile und Macht der Hof und der Herr ist, dem er dient. In der romantischen Poesie wird das Ideal der inneren Vollkommenheit und Spiritualität des Ritters bewusst mit Macht und Besitz in den Händen weniger Würdiger, die keine so reine Seele haben, kontrastiert.
1 von 23
Präsentation – Das Ideal der edlen Ritterlichkeit
Text dieser Präsentation
Thema: Das Ideal der edlen Ritterlichkeit
Städtische Haushaltsbildungseinrichtung Sadovskaya-Sekundarschule, Zweigstelle des Dorfes Lozovoye, Dorf Lozovoye, Bezirk Tambow, Region Amur
MHC. Klasse 7 Zusammengestellt von der Lehrerin für russische Sprache und Literatur Efimova Nina Vasilievna

Hausaufgabenkontrolle Erzählen Sie uns etwas über das rechtschaffene Leben des Heiligen Georg des Siegreichen. Warum wurde er zur Verkörperung des Verteidigers des Vaterlandes? Erzählen Sie uns von den Kunstwerken, die das Bild des legendären Helden – St. Georg dem Siegreichen – einfangen. Warum ist das Bild des Heiligen Georg des Siegreichen auf dem Wappen der Stadt Moskau abgebildet?
Moskauer Wappen

Wortschatzarbeit. Minnesänger waren professionelle Sänger, die Ritterlichkeit und Dienst an einer schönen Dame besangen. Ein Ritterturnier ist ein militärischer Ritterwettbewerb im mittelalterlichen Westeuropa. Herold – Bote, Herold bei Gericht, Turnierrichter.
Ritterturnier
Minnesänger

Das Mutterland ist deine Mutter, sei in der Lage, dafür einzustehen.
Es war einmal ein armer Ritter, schweigsam und einfach, düster und blass im Aussehen, mutig und direkt im Geiste, - A.S. Puschkin Die Blütezeit des Rittertums - XII-XIV Jahrhundert. Der Ritter wurde im Mittelalter zum Ideal des Menschen.

Der Rittertitel ist ein Ehrentitel eines edlen Kriegers, der sich strikt an den Ehrenkodex hält, nach dem er sein Vaterland verteidigen, in Schlachten Furchtlosigkeit zeigen, seinem Herrn (Meister) treu sein und die Schwachen beschützen muss: Frauen, Witwen und Waisen.

Der tapfere Ritter befolgte diesen Kodex strikt, achtete auf seine eigene Würde, beging keine unehrenhaften Taten, beherrschte die Fähigkeit, sich in der Gesellschaft einer Dame seines Herzens zu benehmen, und ließ sich nie erniedrigen.
Der ritterliche Ehrenkodex lautete: „Seien Sie Gott, Ihrem Herrscher und Freund, treu, seien Sie langsam in der Rache und Bestrafung und schnell in der Barmherzigkeit und helfen Sie den Schwachen und Wehrlosen, geben Sie Almosen.“

Das Hauptereignis für jeden Ritter war die Ritterzeremonie nach 21 Jahren. Am Morgen vor dem Ritual wurde der Ritter als Zeichen der Reinigung und des Eintritts in ein neues Leben ins Badehaus gebracht. Die Zeremonie selbst fand im Schloss statt, wo in feierlicher Atmosphäre dem Eingeweihten eine Rüstung verliehen wurde und der zukünftige Ritter vor dem Priester einen Eid ablegte.

Kult der schönen Dame
Der Kult der schönen Dame hat seinen Ursprung in Südfrankreich. Grundlage des Kultes ist die Verehrung der Jungfrau Maria, zu deren Ehren inbrünstige Gebete gesprochen und Gedichte verfasst wurden. Nach den gängigen Ansichten der damaligen Zeit sollte ein Ritter nicht nach gemeinsamer Liebe streben. Die Dame seines Herzens sollte für ihn unerreichbar und unzugänglich sein. Diese Liebe wurde zur Quelle aller Tugend und war Teil der ritterlichen Gebote.

Das Aussehen eines mittelalterlichen Ritters: Auf einem Pferd sitzend, sein Körper ist durch ein Kettenhemd mit Kapuze geschützt (ab dem 14. Jahrhundert wurde das Kettenhemd durch Rüstungen ersetzt - Metallplatten), Arme und Beine sind mit Metallstrümpfen und Handschuhen bedeckt sein Kopf ist ein eiserner Helm mit beweglichem Visier, in seinen Händen hält er ein Schwert oder einen Speer (bis 4,5 m), auf dem Schild waren Wappen und Motto des Ritters abgebildet.
Das Bild eines Ritters und ritterlicher Turniere.
Ritter, Kleidung und Ausrüstung aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Das Leben mittelalterlicher Ritter war von ständigen Schlachten geprägt; sie begaben sich gerne auf gefährliche Reisen und Feldzüge. Der Tod im Kampf galt als Heldentat und Mut.
Schlacht von Lewes (14. Mai 1264)

Die militärischen Fähigkeiten der Ritter wurden bei Turnieren ausgebildet und verfeinert, die an wichtigen Feiertagen oder zu Ehren eines bedeutenden Ereignisses stattfanden. Bevor sie begannen, wurden alle von den Rittern vollbrachten Taten detailliert aufgelistet und teilweise grandiose Szenen militärischer Schlachten nachgebildet.
Ritterturnier (spätes 14. Jahrhundert)

Die Wettbewerbsregeln wurden im 11. Jahrhundert formuliert. Sie verbot es, außerhalb der Reihe zu kämpfen, Pferden Wunden zuzufügen oder den Kampf fortzusetzen, nachdem der Feind sein Visier gehoben oder seine Waffe niedergelegt hatte. Die Herolde riefen die Namen derjenigen, die in die Schlacht zogen. Sie sorgten dafür, dass die Regeln eingehalten wurden, und flehten die Damen an, den Kampf zu beenden, wenn die Leidenschaften überhand nahmen.
Herald ist Turnierrichter.

Eine übliche Form von Turnieren waren Duelle. Sie kämpften zu Pferd mit stumpfen Speeren und Schwertern. Die Hauptaufgabe bestand darin, den Feind aus dem Sattel zu werfen und ihn in die Brust zu schlagen. Dieses Spektakel endete mit der Preisverleihung an den Gewinner, der seine Leistung in der Regel der Dame seines Herzens widmete.

Echte Schlachten waren äußerst heftig, wenn auch nicht immer blutig, weil Der Ritter war sehr gut geschützt. Es ist beispielsweise bekannt, dass an einer der größten Schlachten 900 Ritter teilnahmen, dabei jedoch nur drei getötet und 140 Menschen gefangen genommen wurden.

Die mutigen Taten der Ritter werden durch berühmte literarische Werke gewürdigt. Ab dem 12. Jahrhundert entstand in Westeuropa eine reiche mittelalterliche Literatur. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl von Genres aus: Romane, Heldenepen, Ritterpoesie, die sonnige „Geschichte der Könige von Großbritannien“.
Rittertaten in literarischen Werken

Die berühmtesten Heldenepen waren: „Das Lied von Roland“ (Frankreich), „Das Lied von meinem Cid“ (Spanien), „Das Lied der Nibelungen“ (Deutschland).
Illustration zum Epos „Nibelungenlied“
Cover des Buches „Das Lied von Roland“

Besonders beliebt war das „Rolandlied“ (12. Jahrhundert), das von umherziehenden Minnesängern auf Stadtplätzen bei lauten Volksfesten und am Königshof aufgeführt wurde. Mehr als einmal inspirierte sie Krieger vor dem Kampf.
Illustration zum Epos „Das Lied von Roland“

Die Hauptfigur, der mächtige und tapfere Ritter Roland, Neffe des französischen Königs Karl der Große, verteidigt tapfer das „süße“, „zärtliche“ Frankreich: Niemand soll über mich sagen, dass ich aus Angst meine Pflicht vergessen habe. Ich werde meine Familie niemals blamieren. Wir werden den Ungläubigen einen großen Kampf liefern.

Seine Abteilung ist von einem Feind umgeben, der um ein Vielfaches größer ist als seine Armee. Die Feinde nähern sich und in der Schlacht wird Roland schwer verwundet, kämpft aber weiter. Roland sah, dass die Schlacht nicht von Dauer sein würde. Wie ein Löwe oder ein Leopard wurde er stolz und wild ... Kein einziger Franzose kennt Angst, und es gibt zwanzigtausend von ihnen in unserem Regiment. Ein Vasall dient seinem Herrn. Er erträgt die Kälte und Hitze des Winters. Es ist kein Mitleid, Blut für ihn zu vergießen ... ... Ich schwöre dir beim König des Himmels, die ganze Wiese ist mit den Körpern von Rittern übersät. Ich trauere von ganzem Herzen um das liebe Frankreich: Es hat seine treuen Verteidiger verloren ...
Illustrationen aus dem Buch „Das Lied von Roland“

Im letzten Moment bläst er in die Hupe und gibt Karl ein Zeichen, um ihn vor der Gefahr zu warnen. Der Held stirbt, wie es sich für einen tapferen Ritter gehört. Er versucht, sein Schwert zu zerbrechen, damit der Feind es nicht erwischt. Roland stirbt, indem er Schwert und Horn auf seine Brust legt und sein Gesicht nach Spanien wendet, woher der Feind kam: Der Graf spürte, dass ihm der Tod bevorstand. Kalter Schweiß rinnt dir über die Stirn. Er geht unter einer schattigen Kiefer und legt Schwert und Horn auf seine Brust. Er wandte sein Gesicht nach Spanien, damit König Karl, wenn er und seine Armee wieder hier sind, sehen konnte, dass der Graf starb, aber in der Schlacht siegte.
Illustrationen aus dem Buch „Das Lied von Roland“

Im 12.-13. Jahrhundert erschienen Ritterromane, die Mut und Treue, die ritterliche Liebe und den Kult der schönen Dame verherrlichten. Die berühmtesten waren: Legenden über die Heldentaten des Königs der alten Briten - Arthur, die wunderbare „Geschichte von Tristan und Isolde“, der Versroman „Ivain oder der Ritter des Löwen“.
Statue von König Artus
„Das Märchen von Tristan und Isolde“
„Yvain oder der Ritter des Löwen“

Franz I., König von Frankreich, ein brillanter Ritter, zeichnete sich durch rücksichtslosen Mut aus. Seine Regierungszeit war von langen Kriegen in Europa geprägt.
Gemälde des Künstlers Giorgione. „Ritter und Knappe“

Literatur. Programme für weiterführende Schulen, Gymnasien, Lyzeen. Weltkunst. 5-11 Klassen. G. I. Danilova. M.: Bustard, 2007. Lehrbuch „World Art Culture“. Klassen 7–9: Grundniveau. G. I. Danilova. Moskau. Trappe. 2010 Wikipedia – https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Code zum Einbetten eines Präsentationsvideoplayers in Ihre Website:
Beschreibung der Präsentation anhand einzelner Folien:
1 Folie
Folienbeschreibung:
2 Folie
Folienbeschreibung:
Der Ritterorden galt als königliche Belohnung für öffentliche Verdienste. Im Mittelalter wurden in Europa die Ritterbruderschaften in religiöse und weltliche unterteilt. Zur ersten Klasse gehören Ritter, die ein religiöses Gelübde abgelegt haben. Die zweite Klasse entstand aus Rittern, die in königlichen Diensten standen oder dem Hochadel dienten. Das Rittertum hat seinen Ursprung im mittelalterlichen Frankreich und Spanien, breitete sich anschließend in ganz Europa aus und erlebte im 12. und 13. Jahrhundert seine größte Blüte. Ritterlichkeit kann auch als Verhaltens- und Ehrenkodex angesehen werden, an den sich mittelalterliche Ritter hielten. Die erklärten Grundwerte des Rittertums waren: Glaube, Ehre, Tapferkeit, Adel, Keuschheit und Treue.
3 Folie
Folienbeschreibung:
Ritter ist ein mittelalterlicher adliger Ehrentitel in Europa. Das Rittertum entstand im Zusammenhang mit dem Übergang vom Volksfußheer zum Kavallerieheer der Vasallen. Die Blütezeit des Rittertums war das 12.-14. Jahrhundert.
4 Folie
Folienbeschreibung:
Rittertum wurde in mittelalterlichen lateinischen Texten mit den Worten „Anlegen eines militärischen Gürtels“ bezeichnet. Lange Zeit konnte jeder Ritter werden. Zunächst wurde die Ritterschaft nach deutscher Tradition im Alter von 12, 15, 19 Jahren verliehen, doch im 13. Jahrhundert war der Wunsch spürbar, sie bis ins Erwachsenenalter, also bis zum 21. Lebensjahr, zurückzudrängen. Jeder Ritter konnte zum Ritter schlagen, aber häufiger taten dies die Verwandten des Widmungsträgers, Herren, Könige und Kaiser, die dieses Recht für sich behalten wollten. Übergangsritus – Auszeichnung
5 Folie
Folienbeschreibung:
Im 11.-12. Jahrhundert gesellte sich zum deutschen Brauch der Waffenpräsentation das Ritual des Bindens goldener Sporen, des Aufsetzens eines Kettenhemds und eines Helms sowie des Badens vor dem Ankleiden. Später wurde es hinzugefügt – Colée, oder ein Schlag mit der Handfläche auf den Hals. Es war eine Prüfung der Demut für den Ritter und breitete sich vom Norden aus aus. Dies ist der einzige Schlag im ganzen Leben des Ritters, den er ohne Rückkehr einstecken konnte. Gegen Ende des Rituals sprang der Ritter auf sein Pferd, ohne die Steigbügel zu berühren, galoppierte und schlug mit seinem Speer auf die an den Stangen montierten Schaufensterpuppen ein. Auszeichnung
6 Folie
Folienbeschreibung:
Ein Ritterturnier war ein militärischer Wettkampf der Ritter im mittelalterlichen Westeuropa. Vermutlich begann man in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mit der Austragung von Turnieren. Die Heimat der Turniere ist Frankreich. Ursprünglich dienten Turniere dazu, die Kriegskünste in Friedenszeiten zu erlernen und erfahrenen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ritterturnier
7 Folie
Folienbeschreibung:
Der „Vater“ des Turniers heißt Geoffroy de Preilly (gestorben 1066). Er schrieb die Regeln für die ersten Turniere. Interessanterweise wurde Geoffroy de Preilly bei einem Turnier getötet, für das er selbst die Regeln schrieb. Der Zweck des Turniers besteht darin, die Kampfqualitäten der Ritter zu demonstrieren. Turniere wurden in der Regel vom König, den großen Herren, zu besonders feierlichen Anlässen organisiert: zu Ehren der Hochzeiten von Königen, Fürsten von Blut, im Zusammenhang mit der Geburt von Erben, dem Friedensschluss usw. Ritter aus ganz Europa versammelten sich dazu Turniere. Ritterturnier
8 Folie
Folienbeschreibung:
Für das Turnier wurde ein geeigneter Ort in der Nähe einer Großstadt ausgewählt, die sogenannten „Listen“. Das Stadion hatte eine viereckige Form und war von einer hölzernen Barriere umgeben. In der Nähe wurden Bänke, Logen und Zelte für Zuschauer aufgestellt. Der Ablauf des Turniers wurde durch einen besonderen Kodex geregelt, dessen Einhaltung durch Herolde überwacht wurde; sie gaben die Namen der Teilnehmer und die Bedingungen des Turniers bekannt. Ritterturnier
Folie 9
Folienbeschreibung:
Herold – Herold, Bote, Zeremonienmeister an den Höfen von Königen und großen Feudalherren; Manager bei Feiern und Ritterturnieren. Der Herold war auch Richter des Turniers: Er gab ein Zeichen für den Beginn des Turniers und konnte einen allzu heftigen Kampf stoppen. Der Herold war für die Zusammenstellung von Wappen und Genealogie zuständig. Herold
10 Folie
Folienbeschreibung:
Die Turnierteilnehmer – Ritter und Knappen – versuchten, sich für das Turnier möglichst bunt und schön zu kleiden. Die Zuschauer waren genauso gekleidet – in den modischsten Klamotten. Somit war das Turnier nicht nur eine Demonstration ritterlicher Tapferkeit, sondern auch eine Art Präsentation der neuesten Mode in Kleidung, Rüstungen und Waffen. Ritterturnier
11 Folie
Folienbeschreibung:
Für einen Ritter gab es mehrere wichtige Dinge – Glaube, Ehre, Dame des Herzens. Für einen solchen Krieger steht die Treue zum Herrn immer an erster Stelle; Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens. Ehre bestand darin, einen Eid und einen Moralkodex einzuhalten. Niemand hatte das Recht, die Ehre eines Ritters ohne Konsequenzen zu diskreditieren. Der Krieger musste seine Ehre verteidigen und konnte einen Gegner zum Duell herausfordern. Ritterliche Tugenden
Der französische Historiker M. Blok glaubte, dass „die ritterliche Idee aus der Ethik des fairen Kampfes entstand, deren Regeln man im christlichen Europa bis zum Ende des 15. Jahrhunderts einzuhalten versuchte, als angeheuerte Landsknechte mit ihren riesigen Trommeln die Vorherrschaft übernahmen.“ Auf den Schlachtfeldern (ein dem barbarischen Osten entlehnter Brauch), dessen Klang eine rein hypnotische Wirkung hat und jeglicher Musikalität entbehrt, markierte einen markanten Übergang von der Ritterzeit zur Moderne.
Im bewaffneten Kampf sehen wir Beispiele für den Kampf im Allgemeinen, einen Kampf, der das gesamte Leben eines Menschen in allen Jahrhunderten durchdringt, unabhängig davon, ob er militärische Waffen trägt oder nicht.“
Innerhalb dieser Logik war der mittelalterliche Feudalritter frei und mutig, da er dem Anführer die Treue schwor. Laut I. Iljin „baut ein ritterlicher Mann sein Leben auf freien Gehorsam auf. Er trägt die Last seines Dienstes mit gutem Willen , und genau deshalb wird die Auslöschung der Sterblichen für ihn zu einem Machtakt.“
Über Jahrhunderte hinweg haben sich ritterliche Traditionen und besondere ethische Maßstäbe herausgebildet. Der Ehrenkodex basierte auf dem Prinzip der Loyalität gegenüber dem Oberherrn und der Pflicht. Zu den ritterlichen Tugenden gehörten militärischer Mut und Gefahrenverachtung, Stolz, eine edle Haltung gegenüber Frauen und Aufmerksamkeit für hilfsbedürftige Mitglieder ritterlicher Familien. Geiz und Geiz wurden verurteilt und Verrat nicht vergeben.
Der Ritterorden enthält vier ritterliche Gebote; eine spätere Quelle erhöhte die Zahl auf zehn; hier sind sie:
1. Ohne Taufe kann man kein Ritter sein.
2. Das Hauptanliegen eines Ritters ist der Schutz der Kirche.
3. Ebenso wichtig ist es, die Schwachen, Witwen und Waisen zu schützen.
4. Der gesamte Weg eines Ritters ist von der Liebe zu seinem Heimatland geheiligt.
5. Auf diesem Weg muss er immer mutig sein.
6. Er ist verpflichtet, Ungläubige, Feinde der Kirche und des Vaterlandes zu bekämpfen.
7. Die Pflicht eines Ritters ist die Treue gegenüber dem Herrn.
8. Ein Ritter ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen und sein Wort zu halten.
9. Nichts ziert einen Ritter mehr als Großzügigkeit.
10. Ein Ritter ist stets verpflichtet, das Böse zu bekämpfen und gleichzeitig das Gute zu verteidigen.
Obwohl diese Klassifizierung durch eine gewisse Künstlichkeit gekennzeichnet ist, spiegelt sie im Allgemeinen recht genau den Komplex von Eigenschaften und Tendenzen wider, die für einen treuen Ritter charakteristisch sind. Und doch sind das nichts weiter als gute Wünsche.
Zweifellos erfüllten nicht alle Ritter die hohen ethischen Standards, die das menschliche Bewusstsein dieser Zeit hervorbrachten. Unter ihnen waren Räuber und Mörder. Sie bestimmten jedoch nicht den allgemeinen Verhaltensstil der Elite, die alle diese Abweichungen von der Norm größtenteils verurteilte. Selbstaufopferung auf dem Schlachtfeld, die Fähigkeit, ohne Zögern sein Leben für den Souverän und das Vaterland hinzugeben, galt als Norm. Eine solche Einstellung zur eigenen Pflicht schuf eine gewisse allgemeine Einstellung, die man als „spirituelle Tapferkeit“ bezeichnen kann; es war diese spirituelle Tapferkeit, so die Ideologen des Mittelalters, die dazu beitrug, „andere Menschen im Einklang mit dem Göttlichen zu führen“. Gebote.“
Die Reflexion der ritterlichen Moral im Bereich der spirituellen Kultur bot einen fruchtbaren Boden für die Entwicklung der mittelalterlichen Literatur mit ihrem eigenen besonderen Flair, Genre und Stil. Sie poetisierte irdische Freuden trotz christlicher Askese, verherrlichte Heldentum und verkörperte ritterliche Ideale nicht nur, sondern prägte sie auch. Neben dem Heldenepos von höchst patriotischem Klang (zum Beispiel das französische „Lied von Roland“, das spanische „Lied von meinem Cid“) erschien auch ritterliche Poesie (zum Beispiel die Texte von Troubadours und Trouveres in Frankreich und den Minnesängern). in Deutschland) und einem Ritterroman (die Liebesgeschichte von Tristan und Isolde), der die sogenannte „höfische Literatur“ (von französisch courtois – höflich, ritterlich) mit dem obligatorischen Damenkult darstellt.
Die Legenden über den mythischen König Artus und die Ritter der Tafelrunde spiegelten alle idealen Eigenschaften eines Ritters wider.
Der Ritter musste aus einer guten Familie stammen. Zwar wurden sie manchmal für außergewöhnliche militärische Leistungen zum Ritter geschlagen, aber fast alle Ritter der Tafelrunde stellen ihre Herkunft zur Schau, darunter viele königliche Söhne, fast jeder hat einen luxuriösen Stammbaum.
Ein Ritter muss sich durch Schönheit und Attraktivität auszeichnen. Die meisten Artus-Zyklen enthalten eine detaillierte Beschreibung der Helden sowie ihrer Kleidung und betonen dabei die äußeren Vorzüge der Ritter.
Der Ritter brauchte Kraft, sonst konnte er keine Rüstung tragen, die sechzig bis siebzig Kilogramm wog. Diese Stärke zeigte er in der Regel in seiner Jugend. Arthur selbst zog ein Schwert heraus, das zwischen zwei Steinen steckte, als er noch sehr jung war (allerdings war etwas Magie im Spiel).
Ein Ritter muss über berufliche Fähigkeiten verfügen: ein Pferd kontrollieren, eine Waffe führen usw.
Von einem Ritter wurde erwartet, dass er unermüdlich nach Ruhm strebte. Ruhm erforderte ständige Bestätigung und die Bewältigung immer neuer Herausforderungen. Yvain aus Chretien de Troyes‘ Roman „Yvain oder der Ritter des Löwen“ kann nach der Hochzeit nicht bei seiner Frau bleiben. Freunde sorgen dafür, dass er sich nicht durch Untätigkeit verwöhnen lässt und erinnern sich daran, wozu sein Ruhm ihn verpflichtet. Er musste umherwandern, bis sich die Gelegenheit ergab, mit jemandem zu kämpfen. Es hat keinen Sinn, gute Taten zu vollbringen, wenn sie dazu bestimmt sind, unbekannt zu bleiben. Stolz ist völlig berechtigt, solange er nicht übertrieben wird. Rivalität um Prestige führt zu einer Schichtung innerhalb der kämpfenden Elite, obwohl im Prinzip alle Ritter als gleich angesehen werden, was in den Artuslegenden durch die Tafelrunde symbolisiert wird, an der sie sitzen.
Es ist klar, dass bei solch einer ständigen Sorge um Prestige von einem Ritter Mut verlangt wird, und der schwerste Vorwurf ist der Vorwurf des Mangels an Mut. Die Angst, der Feigheit verdächtigt zu werden, führte zu einem Verstoß gegen die elementaren Regeln der Strategie (so verbietet Erec im Roman „Erec und Enida“ von Chrétien de Troyes dem vorausfahrenden Enide, ihn vor der Gefahr zu warnen). Manchmal endete dies mit dem Tod des Ritters und seiner Truppe. Mut ist auch notwendig, um die Pflicht zur Treue und Loyalität zu erfüllen.
Die unerbittliche Rivalität verletzte nicht die Solidarität der ritterlichen Elite als solche, die sich auch auf die Feinde erstreckte, die zur Elite gehörten. In einer der Legenden prahlt ein einfacher Krieger damit, einen edlen Ritter des feindlichen Lagers getötet zu haben, doch der edle Kommandant befiehlt, den stolzen Mann zu hängen.
Wenn für einen Ritter als Militär Mut notwendig war, dann kam er mit seiner Großzügigkeit, die von ihm erwartet wurde und als unverzichtbares Eigentum eines Adligen galt, den von ihm abhängigen Menschen und denen, die die Heldentaten der Ritter verherrlichten, zugute Höfe in der Hoffnung auf eine gute Belohnung und dem Anlass entsprechende Geschenke. Nicht umsonst wird in allen Legenden um die Ritter der Tafelrunde den Beschreibungen von Festen und Geschenken zu Ehren einer Hochzeit, Krönung (manchmal zusammenfallend) oder eines anderen Ereignisses nicht der geringste Platz eingeräumt.
Ein Ritter muss bekanntlich seinen Verpflichtungen gegenüber seinesgleichen bedingungslos treu bleiben. Der Brauch, seltsame ritterliche Gelübde abzulegen, die entgegen allen Regeln des gesunden Menschenverstandes erfüllt werden mussten, ist bekannt. Daher weigert sich der schwer verwundete Erec, mindestens ein paar Tage im Lager von König Artus zu leben, damit seine Wunden heilen können, und macht sich auf die Reise, wobei er riskiert, im Wald an seinen Wunden zu sterben.
Die Klassenbrüderlichkeit hinderte die Ritter nicht daran, ihrer Rachepflicht für jede Beleidigung, ob real oder eingebildet, nachzukommen, die dem Ritter selbst oder seinen Angehörigen zugefügt wurde. Die Ehe war nicht besonders stark: Der Ritter war ständig außerhalb des Hauses auf der Suche nach Ruhm, und die allein gelassene Frau wusste sich normalerweise für seine Abwesenheit zu „belohnen“. Die Söhne wuchsen am Hofe anderer auf (Arthur selbst wuchs am Hofe von Sir Ector auf). Aber der Clan zeigte Einigkeit; wenn es um Rache ging, trug auch der gesamte Clan Verantwortung. Es ist kein Zufall, dass im Artuszyklus der Konflikt zwischen zwei großen rivalisierenden Gruppen – den Anhängern und Verwandten Gawains einerseits und den Anhängern und Verwandten Lancelots andererseits – eine so wichtige Rolle spielt.
Der Ritter hatte gegenüber seinem Oberherrn eine Reihe von Verpflichtungen. Den Rittern oblag besondere Dankbarkeit gegenüber demjenigen, der sie zum Ritter weihte, sowie die Fürsorge für Waisen und Witwen. Obwohl der Ritter jedem helfen sollte, der Hilfe brauchte, sprechen die Legenden nicht von einem einzigen schwachen Mann, der vom Schicksal beleidigt wurde. Bei dieser Gelegenheit ist es angebracht, die witzige Bemerkung von M. Ossovskaya zu zitieren: „Sogar der Ritter des Löwen schützt beleidigte Mädchen umfassend: Er befreit dreihundert Mädchen von der Macht eines grausamen Tyrannen, die in Kälte und Hunger weben müssen.“ Stoff aus Gold- und Silberfäden verdient es, in der Betriebsliteratur erwähnt zu werden.
Es war nicht so sehr der Sieg, der dem Ritter Ruhm einbrachte, sondern sein Verhalten im Kampf. Der Kampf hätte mit einer Niederlage und dem Tod enden können, ohne seiner Ehre Schaden zuzufügen. Der Tod im Kampf war sogar ein guter Abschluss der Biografie – es war für den Ritter nicht einfach, sich mit der Rolle eines gebrechlichen alten Mannes auseinanderzusetzen. Der Ritter war verpflichtet, dem Feind nach Möglichkeit gleiche Chancen zu geben. Wenn der Feind vom Pferd fiel (und er in Rüstung ohne fremde Hilfe nicht in den Sattel klettern konnte), stieg derjenige, der ihn niedergeschlagen hatte, ebenfalls ab, um die Chancen auszugleichen. „Ich werde niemals einen Ritter töten, der von seinem Pferd gefallen ist!“, ruft Lancelot aus.
Die Schwäche eines Feindes auszunutzen, brachte dem Ritter keinen Ruhm, und das Töten eines unbewaffneten Feindes erfüllte den Mörder mit Schande. Lancelot, ein Ritter ohne Angst und Vorwurf, konnte es sich nicht verzeihen, dass er in der Hitze des Gefechts irgendwie zwei unbewaffnete Ritter getötet hatte und es bemerkte, als es zu spät war; Er pilgerte zu Fuß und trug nur ein maßgeschneidertes Hemd, um diese Sünde zu sühnen. Es war unmöglich, von hinten anzugreifen. Der Ritter in der Rüstung hatte kein Recht, sich zurückzuziehen. Alles, was man als Feigheit bezeichnen könnte, war inakzeptabel.
Der Ritter hatte in der Regel einen Liebhaber. Gleichzeitig konnte er einer Dame seines Standes, die ihm gegenüber manchmal eine höhere Stellung innehatte, nur Verehrung und Fürsorge zeigen. Entgegen der landläufigen Meinung waren Seufzer aus der Ferne eher die Ausnahme als die Regel. In der Regel war die Liebe nicht platonisch, sondern fleischlich, und ein Ritter erlebte sie für die Frau eines anderen, nicht für seine eigene (ein klassisches Beispiel sind Lancelot und Guinevere, Arthurs Frau).
Liebe musste einander treu sein, Liebende mussten verschiedene Schwierigkeiten überwinden. Der schwierigste Test, dem die Dame seines Herzens einen Liebhaber unterziehen kann, ist Lancelots Guinevere, die er um den Preis der Schande rettet. Der Liebhaber sucht nach Guinevere, die von bösen Mächten entführt wurde, und sieht einen Zwerg auf einem Karren fahren. Der Zwerg verspricht Lancelot, das Versteck von Guinevere zu verraten, vorausgesetzt, dass der Ritter in den Karren steigt – eine Handlung, die den Ritter entehren und ihn lächerlich machen kann (Ritter wurden nur zur Hinrichtung in einem Karren getragen!). Lancelot beschließt schließlich, dies zu tun, doch Guinevere ist von ihm beleidigt: Bevor er in den Karren stieg, machte er noch drei Schritte.
So schuf das Rittertum das heroische Ideal eines christianisierten, tapferen Ritters und das weltliche Ideal der Höflichkeit, in dem sowohl militärische als auch höfische Tugenden vereint sind – sowohl Mut als auch Höflichkeit, aber nicht heroische höfische Tugenden werden zu den wichtigsten.
Im 13. Jahrhundert. kommt eine anspruchsvollere Höflichkeit mit dem Ideal der Makellosigkeit. Eine höfische Persönlichkeit und ein „Ehrenmann“ ist Träger einer säkularen Hofkultur, unterhaltungsorientiert, entmilitarisiert und dem Gedanken der persönlichen Selbstverwirklichung fremd. Ansonsten wird Höflichkeit auch als Großzügigkeit, Höflichkeit, Vornehmheit und Vornehmheit bezeichnet. Großzügigkeit scheint die besten ritterlichen Eigenschaften (Macht, Mut, Ehre, Großzügigkeit) sowie Aufklärung zu implizieren, ganz zu schweigen von Eigentum und sozialem Status.
Höflichkeit steht im Gegensatz zu Unhöflichkeit, Gier, Geiz, Hass, Rache und Verrat. Maskiert die Psychologie der Macht, romantisiert und problematisiert den Alltag, schützt das Selbstbewusstsein der Klasse.
Höflichkeit drückt sich in romantischer Liebe und höfischer Freundschaft aus, die nichts mit der Psychologie der Ehe zu tun haben. Die Familie lebt mit legalisierter Untreue und Polygamie zusammen. Liebe dieser Art erfordert die Idealisierung des Objekts der Anbetung, des Respekts und der Angst. Es ist bemerkenswert, dass die Geliebte bei ihrem Ritterverehrer Angst hervorrufen sollte.
Das Ideal eines gebildeten Höflings impliziert Alphabetisierung, Beredsamkeit, äußere Attraktivität und Schönheit, Gelehrsamkeit, Harmonie des „inneren Menschen“ und Aussehens, Mäßigung und Toleranz, Einsicht und Bescheidenheit.
Das höfische Ethos lässt die alte Idee der Kalokagathia wieder aufleben; Moral und Moral werden mit Ästhetik, einer verfeinerten Form des äußeren Verhaltens, kombiniert.
Das ist einerseits eine Maske, hinter der sich kein Humanismus, sondern List und Pragmatismus verbirgt. Andererseits stellt die höfische Moral ein Beispiel für den mittelalterlichen Personenkult dar und dient als Prolog zu den Werten der ohnehin nichtfeudalen herrschenden Klasse, die sich durch das Konzept des aktiven Lebens und dann durch das Konzept durchsetzte der individuellen Freiheit, Werte, die die Wurzeln der europäischen Renaissance nähren.
Im frühen Mittelalter etablierte sich der Ritter als unabhängiger, tapferer Reiterkrieger. In dieser Eigenschaft war es schwierig, ihn von einem Banditen und Eindringling zu unterscheiden. Er wurde von anarchischen, destruktiven und sogar kriminellen Neigungen dominiert. Anschließend werden im Porträt des idealen Ritters Barmherzigkeit und christliche Fürsorge für die Schwachen und Beleidigten zu den Hauptmerkmalen. Es entsteht ein ethischer Mythos über den Ritter-Verteidiger, der sowohl weltliche als auch moralisch-religiöse Funktionen ausübt. Die nächste Stufe in der Entwicklung des ritterlichen Ideals ist der Kodex edler Manieren und die Ideologie der Liebe, die den Ritter nicht für militärische Siege und Heldentum, sondern für seine inneren Tugenden, seine „schöne Seele“ und seinen Verhaltensstil verherrlicht. Die Wörter „würdig“ und „Würde“ verdrängen nach und nach die Wörter „Held“ und „heldenhaft“. Der Hofritter versucht, mit Ausnahme einer Frage der persönlichen Ehre, keine Prinzipien aufrechtzuerhalten.
Daraus lässt sich schließen, dass das Rittertum nicht über Jahrhunderte hinweg ein lebenswichtiges Ideal gewesen wäre, wenn es nicht die für die gesellschaftliche Entwicklung notwendigen hohen Werte besessen hätte, wenn kein Bedarf dafür im sozialen, ethischen und ästhetischen Sinne bestanden hätte. Auf schönen Übertreibungen beruhte die Stärke des ritterlichen Ideals.
Die Ritterlichkeit wurde vom damaligen Klerus, Minnesängern, Bürgern, Bauern und den Rittern selbst kritisiert.
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kommt die Haltung des Bauern gegenüber dem Ritter in einem von Alain Chartier zitierten Gespräch zwischen einem Herrn und einem Bauern zum Ausdruck, und es ist unwahrscheinlich, dass dies das erste Dokument war, das Beschwerden eines Bauern dagegen enthielt sein Meister. „Die Skrupellosen und Faulenzer ernähren sich von der Arbeit meiner Hände, und sie verfolgen mich mit Hunger und Schwert … Sie leben von mir, und ich sterbe für sie.“ Sie sollten mich vor Feinden schützen, aber leider erlauben sie mir nicht, in Ruhe ein Stück Brot zu essen.
Andere beschuldigten die Ritter der Gier, des Raubes, der Ausschweifung, des Brechens von Eiden und Gelübden, des Schlagens ihrer Frauen und der Umwandlung von Turnieren in ein lukratives Geschäft – der Jagd nach Rüstungen, Waffen und Pferden eines besiegten Ritters. Sie bedauerten die Unwissenheit der Ritter, die größtenteils Analphabeten waren und bei jedem Brief einen Geistlichen rufen mussten.
Früher war die Aristokratie stolz auf ihre Unwissenheit; und sie sagen sogar, dass es Leute gab, die argumentierten, dass jemand, der Latein beherrschte, kein Adliger sein könne. Es besteht kein Zweifel, dass das ritterliche Ideal nicht intellektueller Natur war. Aber er erwartete ein reiches Gefühlsleben.
Es scheint, dass der Geist des Mittelalters mit seinen blutigen Leidenschaften nur dann herrschen konnte, wenn er seine Ideale erhöhte: Das tat die Kirche, und das war auch bei der Idee des Rittertums der Fall.
„Ohne eine solche Raserei bei der Richtungswahl, die sowohl Männer als auch Frauen in ihren Bann zieht, ohne die Würze von Fanatikern und Fanatikern gibt es weder Aufstieg noch Erfolge.“ Um das Ziel zu treffen, müssen Sie etwas höher zielen. In jeder Handlung steckt eine Unwahrheit oder eine Art Übertreibung.“
Je mehr das kulturelle Ideal von den Bestrebungen nach höchsten Tugenden durchdrungen ist, desto größer ist die Diskrepanz zwischen der formalen Seite der Lebensweise und der Realität. Das ritterliche Ideal mit seinem noch halbreligiösen Inhalt konnte nur so lange bekennt werden, wie man die Augen vor dem wahren Sachverhalt verschließen konnte, solange man diese alles durchdringende Illusion spürte. Aber eine erneuerte Kultur strebt danach, die bisherigen Formen von allzu hohen Gedanken zu befreien. An die Stelle des Ritters tritt ein französischer Adliger des 17. Jahrhunderts, der sich zwar an die Standesregeln und die Gebote der Ehre hält, sich aber nicht mehr als Kämpfer für den Glauben, als Verteidiger der Schwachen und Unterdrückten sieht.
Neben dem Ideal einer vollkommenen Persönlichkeit, einem nach evangelischer oder apostolischer Moral lebenden Heiligen, stellte die Feudalzeit das Ideal des „tapferen Ritters“ und dann des „Mannes der Ehre“ in den Vordergrund. Dabei handelt es sich um ein individualistisches, nicht-intellektuelles, in schöne Formen gekleidetes Lebensideal mit hoher ethischer Bedeutung, das über mehrere Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben ist.
Ritterliche Tugenden sollen die Distanz zwischen Trägern adeliger Eigenschaften und Menschen anderer Staaten und Stände verdeutlichen. Die Ritterlichkeit greift auf christliche Symbolik zurück. Die militante Aristokratie begründet ihr Recht auf Krieg allein mit christlichen Prinzipien und greift, um ihren Charakter zu mildern, auf die Ideen christlicher Demut und Barmherzigkeit zurück.
Das Rittertum entstand in der Spätphase der feudalen Gesellschaft in West- und Mitteleuropa im 11.–12. Jahrhundert. und umfasst alle weltlichen Feudalherren oder Teile davon.
Rittertum ist ein kleiner weltlicher Feudalherr, der sich auch vom Klerus unterscheidet, einer Berufsgruppe bestehend aus sozial und wirtschaftlich abhängigen Soldaten und dem Verwaltungsapparat, dem Gefolge eines großen Feudalherrn, der auf seinen Ländereien oder in der Burg selbst lebt. Der Ritter konnte seinen Dienst nicht verlassen. Die Ritter waren Vasallen ihres Oberherrn und erhielten Einkünfte aus den ihnen gewährten Ländereien.
Zum ritterlichen Verhaltenskodex gehören Loyalität, Missachtung von Gefahren und Mut, die Bereitschaft, die christliche Kirche und ihre Geistlichen zu verteidigen und verarmten und schwachen Mitgliedern ritterlicher Familien Hilfe zu leisten.
Das Rittertum schuf das heroische Ideal eines christianisierten, tapferen Ritters und das weltliche Ideal der Höflichkeit, in dem sowohl militärische als auch höfische Tugenden vereint sind – sowohl Mut als auch Höflichkeit, aber nicht heroische höfische Tugenden werden zu den wichtigsten.
13. Jahrhundert kommt eine anspruchsvollere Höflichkeit mit dem Ideal der Makellosigkeit. Eine höfische Persönlichkeit und ein „Ehrenmann“ ist Träger einer säkularen Hofkultur, unterhaltungsorientiert, entmilitarisiert und dem Gedanken der persönlichen Selbstverwirklichung fremd. Ansonsten wird Höflichkeit auch als Großzügigkeit, Höflichkeit, Vornehmheit und Vornehmheit bezeichnet. Großzügigkeit scheint die besten ritterlichen Eigenschaften (Macht, Mut, Ehre, Großzügigkeit) sowie Aufklärung zu implizieren, ganz zu schweigen von Eigentum und sozialem Status.
Höflichkeit steht im Gegensatz zu Unhöflichkeit, Gier, Geiz, Hass, Rache und Verrat. Maskiert die Psychologie der Macht, romantisiert und problematisiert den Alltag, schützt das Selbstbewusstsein der Klasse.
Höflichkeit drückt sich in romantischer Liebe und höfischer Freundschaft aus, die nichts mit der Psychologie der Ehe zu tun haben. Die Familie lebt mit legalisierter Untreue und Polygamie zusammen. Liebe dieser Art erfordert die Idealisierung des Objekts der Anbetung, des Respekts und der Angst. Es ist bemerkenswert, dass die Geliebte bei ihrem Ritterverehrer Angst hervorrufen sollte.
Für einen gebildeten Höfling bedeutet es Alphabetisierung, Beredsamkeit, äußere Attraktivität und Schönheit, Gelehrsamkeit, Harmonie des „inneren Menschen“ und Aussehens, Mäßigung und Toleranz, Einsicht und Bescheidenheit.
Das höfische Ethos lässt die alte Idee der Kalokagathia wieder aufleben; Moral und Moral werden mit Ästhetik, einer verfeinerten Form des äußeren Verhaltens, kombiniert.
Das ist einerseits eine Maske, hinter der sich kein Humanismus, sondern List und Pragmatismus verbirgt. Andererseits stellt die höfische Moral ein Beispiel für den mittelalterlichen Personenkult dar und dient als Prolog zu den Werten der ohnehin nichtfeudalen herrschenden Klasse, die sich durch das Konzept des aktiven Lebens und dann durch das Konzept durchsetzte der individuellen Freiheit, Werte, die die Wurzeln der europäischen Renaissance nähren.
Im frühen Mittelalter etablierte sich der Ritter als unabhängiger, tapferer Reiterkrieger. In dieser Eigenschaft war es schwierig, ihn von einem Banditen und Eindringling zu unterscheiden. Er wurde von anarchischen, destruktiven und sogar kriminellen Neigungen dominiert. Anschließend werden im Porträt des idealen Ritters Barmherzigkeit und christliche Fürsorge für die Schwachen und Beleidigten zu den Hauptmerkmalen. Es entsteht ein ethischer Mythos über den Ritter-Verteidiger, der sowohl weltliche als auch moralisch-religiöse Funktionen ausübt. Die nächste Stufe in der Entwicklung des ritterlichen Ideals ist der Kodex edler Manieren und die Ideologie der Liebe, die den Ritter nicht für militärische Siege und Heldentum, sondern für seine inneren Tugenden, seine „schöne Seele“ und seinen Verhaltensstil verherrlicht. Die Wörter „würdig“ und „Würde“ verdrängen nach und nach die Wörter „Held“ und „heldenhaft“. Der Hofritter versucht, mit Ausnahme einer Frage der persönlichen Ehre, keine Prinzipien aufrechtzuerhalten.